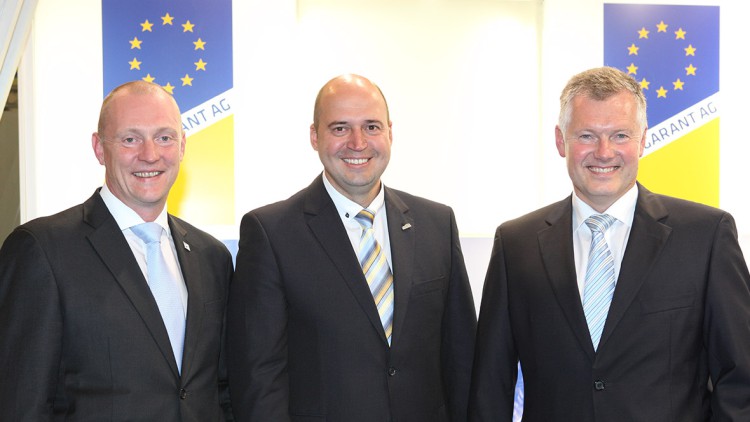Die Aufgabe der Eurogarant AutoService AG lässt sich auf einen sehr prägnanten Nenner bringen: den angeschlossenen Werkstätten geldwerte Vorteile zu verschaffen. Wie man diesen Auftrag weiterhin erfolgreich umsetzen möchte, warum das Setzen langfristiger Ziele in einer schnelllebigen Schadenwelt immer schwieriger wird und wo die größten Herausforderungen für die Reparaturbetriebe liegen, erläutert das Friedberger Führungstrio im AUTOHAUS-Interview.
AH: Herr Börner, mit der Agenda 2020 wollten ZKF und Eurogarant "Leitplanken für die Branche" schaffen – wie erfolgreich war diese Strategie?
P. Börner: Auf der Klausurtagung des Verbandsvorstandes haben wir dazu ein sehr positives Resümee gezogen. Mit repair-pedia, den Dienstleistungen für Betriebe (DfB) und der Erneuerung vieler ZKF-Dienstleistungen ist der Agenda 2020 einiges zu verdanken. Im Hinblick auf die Neubesetzung des Präsidentenamtes durch meine Person und die des Hauptgeschäftsführers Thomas Aukamm haben wir eine sehr wichtige Zielvorgabe strategisch erarbeitet und in die Praxis umgesetzt. Lediglich ein Punkt ist noch offen: die Positionierung einer politischen Interessenvertretung aller Freien Werkstätten – unabhängig ob Service, Mechanik, Karosserie oder Lack. Aber auch hieran wird gerade kräftig gearbeitet.
Ständige Neujustierung
AH: Wo liegen die Schwerpunkte der Arbeit für die kommenden fünf bis zehn Jahre, Herr Fiedler?
T. Fiedler: Selbstverständlich arbeiten wir auch 2019 und darüber hinaus mit einer langfristigen Zielsetzung. Die letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass man sich ständig neu erfinden und positionieren muss. In den Strategiesitzungen des Vorstandes gemeinsam mit einem Ausschuss des Aufsichtsrates stellen wir deshalb die Weichen für die unmittelbar nächsten Schritte. Hier zeigt sich, dass unser satzungsgemäßer Auftrag nicht immer mit den wirtschaftlichen Zielen in Einklang zu bringen ist. Deshalb justieren wir unsere Projekte regelmäßig neu und sind auf einem guten Weg, alle kommenden Herausforderungen auch weiterhin gemeinsam zu meistern.
AH: Herr Kalter, auf der Deutschland Tour 2018 wurden verschiedene Projekte vorgestellt, die den Eurogarant-Betrieben mehr Auslastung ermöglichen sollen. Wie ist der aktuelle Stand in Sachen Dienstleistungen für Flotten, Fuhrparks und Versicherungswirtschaft?
G. Kalter: Entsprechend der Impulse aus dem Markt, der konkreten Anfragen unserer Kunden und einer Überprüfung der Leistungsfähigkeit unseres Netzwerkes haben wir eine Priorisierung vorgenommen. Gute Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit für die angeschlossenen Betriebe und die Auftraggeber stehen dabei im Vordergrund. Das Feedback auf die Umfrage im Rahmen der Deutschland Tour war sehr positiv und lebhaft. Gerade in den Bereichen Glasreparatur und Smart Repair besteht ein großes Werkstattinteresse. Aktuell befinden wir uns in der Analysephase, um das spezielle Know-how der Betriebe mit den vorhandenen Kundenwünschen abzustimmen. Die Aufgabe der Eurogarant ist dabei, das Optimum für beide Seiten herauszuarbeiten und einen reibungslosen, belastbaren und schlanken Prozess zu definieren. Dass wir dies trotz des verschärften Wettbewerbs in den vergangenen Jahren gut gelöst haben, beweist unser gesundes Wachstum, das wir auch in Zukunft ausbauen wollen.
Die Kunst des Spagats
AH: Wie funktioniert der Spagat zwischen konstruktiver Zusammenarbeit mit der Versicherungswirtschaft und dem Abwehren unberechtigter Rechnungskürzungen in der Praxis?
T. Fiedler: Natürlich ist unsere Stellung im Wettbewerbsumfeld nicht immer ganz einfach. Werden nach erfolgter Instandsetzung erforderliche Arbeitspositionen unbegründet und willkürlich gestrichen, setzen wir uns im Rahmen der fachlichen und sachlichen Möglichkeiten für die Werkstätten ein. Ohne die Kürzungsfreude mancher Versicherungen würde es DfB heute schlichtweg nicht geben. Auf der anderen Seite setzen wir uns immer für konkrete Reparaturen ein und bieten jeder Assekuranz die Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Lösung im Dialog an, auch wenn wir 2019 noch mehr Betriebe im Kampf gegen willkürliche Kürzungen unterstützen wollen!
AH: Sie hatten die Bedeutung funktionierender Prozesse bereits angesprochen. Welche Unterstützung können Sie den Eurogarant-Betrieben hier ermöglichen?
G. Kalter: Wir stehen für neue Techniken und innovative Produkte, die nicht selten Benchmark in der Branche sind. Unser Ziel ist es, die Werkstätten gerade nicht durch unerwünschte, zusätzliche administrative Tätigkeiten von ihrer Kernkompetenz, der hochkomplexen Unfallreparatur abzuhalten. Ein Beispiel dafür ist die Fahrerschadenansicht für Flotten und Versicherungskunden, bei der unter strengster Beachtung von Datenschutz und IT-Vorgaben eine valide, echtzeitgesteuerte Transparenz hergestellt wird. Die auf den jeweiligen Flottenverantwortlichen abgestimmten Datenpakete werden systemseitig erzeugt und bedeuten keinerlei Mehraufwand für den Betrieb. Gerade was Kommunikationsstrukturen angeht, suchen wir immer den direkten, unkomplizierten Weg zu den Werkstätten – so auch bei den neuen Schnittstellenprojekten, die keine gesonderten Programme und Systembrüche erforderlich machen. Diese erfolgreiche Ausrichtung auf die Zukunft bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass man manchen digitalen Entwicklungen nicht kritisch bis sehr kritisch gegenüberstehen darf.
Big or Small Data?
AH: Welche Themen sprechen Sie damit konkret an?
G. Kalter: Die Frage ist aus unserer Sicht immer: Ist die Zeit reif für ein Produkt oder eine Dienstleistung oder nicht? Nehmen wir das Beispiel Telegutachten, das wir vor rund zwei Jahren im kleinen Rahmen für einen Versicherungskunden pilotiert haben. Das Feedback aus dem Markt war zurückhaltend bis skeptisch, auch wenn die Technik sicherlich Einzug in den Werkstattalltag finden wird. Deutlich kritischer begegnen wir aktuell Schadenhöhenprognosen mit Hilfe von Big Data. Entscheidend ist, ob zur Referenzierung des vorliegenden Unfallschadens wirklich viele oder doch nur eine überschaubare Anzahl wirklicher Vergleichsdaten herangezogen werden kann und man eher von Small Data sprechen sollte. Darüber hinaus bleibt das Problem der Aussagekraft über die sichtbare Oberfläche hinaus: Kann die angewandte Technologie wirklich die Struktur des Fahrzeuges mit allen betroffenen, möglicherweise teuren Bauteilen richtig erfassen? Für eine erste wertmäßige Annäherung bei leichten Anstößen mögen solche Systeme ausreichen. Als geeignetes Tool für eine genauere Schadenbestimmung sehe ich die künstliche Intelligenz nochweit von der Instandsetzungsrealität entfernt.
AH: Fahrzeugdaten sind auch für Reparaturbetriebe zum unverzichtbaren Handwerkszeug geworden. Wie hat sich das von Ihnen wiederholt eingeforderte "Recht auf Information" entwickelt?
P. Börner: In Bezug auf die Verfügbarkeit von Daten zur fachgerechten Instandsetzung bin ich mittlerweile sehr entspannt – im Grunde ist alles Nötige vorhanden. Skeptisch macht mich eine andere Tatsache, nämlich der teils nachlässige Umgang mit den Informationen in der Werkstatt. An modernen Fahrzeugen dürfen die hinteren Stoßfänger-Verkleidungen auf Grund der darunter verbauten Sensoren und Radargeräte nicht mehr überlackiert werden, um die Funktion der Fahrerassistenzsysteme nicht zu gefährden. Der Betrieb muss sich also vorab informieren, um Reparaturweg und -umfang richtig festlegen zu können. Diese Datenbeschaffung muss mit angemessenen Stundensätzen entlohnt werden, denn wer nur für die Discounter der Schadenlenkung arbeitet, kann sich die entsprechenden repair-pedia-Dokumente nicht leisten und dadurch seine Kompetenz aufbauen. Die Instandsetzung aktueller Modelle verlangt den Betrieben deutlich mehr ab als in der Vergangenheit. Im ZKF-Branchenbericht haben wir aufgezeigt, dass es so nicht weitergehen kann.
AH: Der Verband bemängelt darin auch, dass der leichte Ertragszuwachs einzig auf die erhöhte Handelsleistung im Ersatzteilgeschäft zurückzuführen ist. Wo liegen hier die aktuellen Gefahren?
P. Börner: Versicherungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, haben die Senkung der Reparaturkosten im Blick. Da die Automobilhersteller bei sichtbaren Ersatzteilen über eine Monopolstellung verfügen, können Einsparungen nur auf dem Rücken der Werkstatt erfolgen. Unsere Position ist klar: Der Markt braucht über die ohnehin verfügbaren Ersatzteilplattformen hinaus keine weiteren Angebote, die nur dazu führen, dass Margen schwinden. Vor allem deshalb, weil solche Aktionen die Fahrzeugindustrie nicht von weiteren Preiserhöhungen abhalten werden, sondern die allgemeine Branchensituation eher verschärfen. Gefragt sind partnerschaftliche Lösungen wie Partslift, die allen Beteiligten einen offenen Zugang unter Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaftlichen Interessen ermöglichen. Wir laden gerne alle Versicherer ein, sich von den Vorzügen dieser Plattform ein eigenes Bild zu machen.
Designschutz und seine Folgen
AH: Sehen Sie durch eine mögliche Einführung der Reparaturklausel eine Entspannung der Situation?
P. Börner: Vor dem Hintergrund der neuen Typgenehmigungsverordnung (EU) 2018/858 sehe ich eher zusätzliche Herausforderungen auf die Betriebe zukommen. Wird der Designschutz aufgehoben, können sichtbare Ersatzteile von nahezu jedem hergestellt und vertrieben werden. Die Werkstätten müssen aber sowohl die Sicherheit des Fahrzeuges nach einer Reparatur – denken Sie an den Fußgänger-Aufprallschutz – garantieren, als auch in Bezug etwa auf Korrosion in die Sachmangelhaftung eintreten. Selbst wenn Passgenauigkeit und Verfügbarkeit tatsächlich gegeben wären, es ist keinem Betrieb zuzumuten, Materialproben zu testen und Festigkeitsversuche von geschraubten Querträgern aus dem After Market durchzuführen. Das Kraftfahrzeugtechnische Institut in Lohfelden hat in entsprechenden Studien die gesamten Auswirkungen sehr deutlich gemacht. Der ZKF plädiert deswegen deutlich für qualitativ gleichwertige Ersatzteile bei hoher Verfügbarkeit. Dies schließt auch Identteile mit ein, sofern OEM-identische Qualität und Sicherheit gewährleistet ist.
AH: Die Herausforderungen sind also weiterhin mannigfaltig. Wie kann die Instandsetzungsbranche ihre Zukunft erfolgreich gestalten?
T. Fiedler: Themen wie sinkende Margen und potenzielles Werkstattsterben begleiten mich bereits seit 18 Jahren. Als bekennender Berufsoptimist glaube ich daran, dass sich Qualität auch in Zukunft durchsetzen wird. Die Eurogarant-Fachbetriebe sind sehr gut aufgestellt, um 2025 und darüber hinaus Reparaturen auf höchstem Niveau auszuführen. Voraussetzung dafür sind auskömmliche Stundenverrechnungssätze auch im gelenkten Unfallschaden. Die Unternehmer brauchen mehr Spielraum bei den Gehältern der dringend benötigten Fachkräfte, unbestritten. Bei allen Unkenrufen und Schwarzseherei in unserer Schadenwelt hoffe ich deswegen, dass es nicht erst zu der von vielen Seiten prognostizierten Werkstattverknappung mit Reparaturengpässen kommen muss, ehe die verbliebenen Betriebe ihre Preise deutlich anheben können. Investitionen in die Zukunft sind nötiger denn je und sollten sich auf jeden Fall auch lohnen.
AH: Herr Börner, Herr Fiedler, Herr Kalter – vielen Dank für dieses interessante Gespräch. (kt)